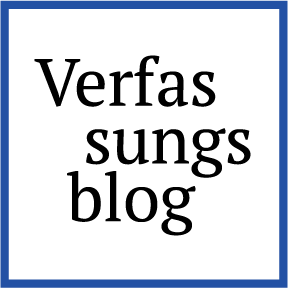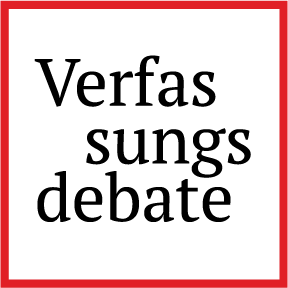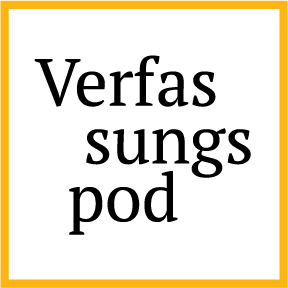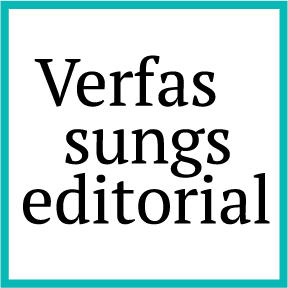Mit Wahrheit oder mit Mehrheit?
Reflexionen zur Migrationsdebatte
Neuer Wahlkampf – Alte Debatten?
Die Regierung ist am Ende, der Weg zu Neuwahlen ist eröffnet. Alle Parteien sind bereits in den Wahlkampfmodus übergegangen, wie insbesondere die parlamentarische Debatte am vergangenen Mittwoch (13.11.2024) bewiesen hat. Doch es lohnt sich einmal kurz innezuhalten und insbesondere einen Blick auf den Migrationsdiskurs in der (fast) vergangenen Regierungszeit von Olaf Scholz zu werfen. Denn daran lässt sich besonders deutlich ein typisches Diskursphänomen zeigen: Der exzessive Rekurs auf Rechtsnormen. Dieses tritt insbesondere auf, wenn ein Politikfeld in besonderer Weise rechtlich determiniert wird und sich eine Diskrepanz zwischen der politischen und der normativen Realität ergibt. Dabei handelt es sich um ein grundlegendes Symptom, das in ähnlicher Weise in einer Vielzahl vergleichbarer Diskurse („Demokratiekrise“, „Klimakrise“) zu finden ist. Doch da bereits abzusehen ist, dass die Migrationsfrage auch im bevorstehenden Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen wird, soll dieser Diskurs hier genauer betrachtet werden.
Rechtswissen als Diskursverschiebung
Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist die Trivialität, dass eine demokratisch verfasste Gesellschaft davon lebt, dass verschiedene politische Gestaltungsvorschläge in einem fairen Wettbewerb um die Gunst der Bürger*innen streiten. Gerade Parteisysteme wie die Bundesrepublik Deutschland können daher als Wettbewerbsdemokratien beschrieben werden, die auf ein egalitäres Überzeugen ausgerichtet sind (vgl. Art. 21 Abs. 1 GG). Das ermöglicht (idealiter) Partizipation, schafft Akzeptanz und sorgt für Stabilität. In einem egalitären Wettbewerb sind autoritative Gefälle daher ein Störfaktor. Denn wer auf Autorität setzt, möchte nicht egalitär überzeugen, sondern erwartet Gefolgschaft (Arendt, Macht und Gewalt, 4. Aufl. 1981, S. 46).
Ein solches Autoritätsgefälle entsteht typischerweise, wenn politische Debatten zu einem Streit um das „bessere“ Wissens mutieren. In unserer Wissensgesellschaft ist dies wenig überraschend und an sich förderlich, sofern es dadurch zu einer Rationalisierung des Meinungsaustausches kommt. Wie der Soziologe Alexander Bogner beschrieben hat, leidet jedoch der offene Ideenwettbewerb, wenn durch den ständigen Rekurs auf (vermeintliche) Sachautorität exkludierende Diskursverschiebungen entstehen (Bogner, Die Epistemisierung des Politischen, 4. Aufl. 2023). In unserem Rechtsstaat gehört das Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen zu den wichtigsten Wissensressourcen für politische Diskussionen. Rechtswissen verleiht dabei erhebliche Sachautorität. Wenn sich Debatten jedoch ausschließlich darauf konzentrieren, ob Rechtsnormen gegen oder für einen politischen Vorschlag sprechen, schließt das Diskursteilnehmende ohne dieses Rechtswissen aus.
Was Alexander Bogner dabei allgemein für die Streitkultur der Wissensgesellschaft diagnostiziert, zeigt sich besonders deutlich in der Migrationsdebatte. Aufgrund des komplizierten hierarchisierten Regelungsregimes im Migrationsrecht, wo Völker-, Europa-, und nationales Recht ineinandergreifen, kommt die Debatte ohne Referenzen auf juristischen Sachverstand von Expert*innen nicht aus. So drehte sich z.B. die Debatte über die Forderung nach Zurückweisungen an den Grenzen fast ausschließlich um die europarechtliche (Un-)Zulässigkeit dieses Vorschlags. Das kann einerseits frustrierend sein, da es exkludierend wirkt, führt andererseits in der Sache auch meist nicht weiter, denn wie sich auch für die jeweilige Stellvertreterdebatte wenig verwunderlich zeigt: „selbst“ Expert*innen sind sich uneins.
Zusätzlich scheint es in der jetzigen – zugegeben manchmal entmutigenden – Lage zur vorherrschenden Strategie zu werden, sich auf die Autorität rechtlich formalisierter Positionen zu verlasen. Statt Kritiker*innen einer offenen Migrationsgesellschaft zu entgegnen, inhuman, unsolidarisch oder praxisfern handeln zu wollen, heißt es immer häufiger schlicht, eine striktere Migrationspolitik verstoße gegen Völker- und/oder Europarecht, die EMRK und (natürlich) gegen die Verfassung. Das ist meist (zu Ausnahmen unten) juristisch zutreffend, reicht aber nicht aus. Denn neben den damit einhergehenden Exkludierungseffekten im Sinne Bogners geraten die sozialen Normen außer Betracht, um die es eigentlich abseits formalisierter Vorschriften geht. Dass die Einführung von Binnengrenzkontrollen an den deutschen Landgrenzen gegen Art. 25 ff. Schengener Grenzkodex (Verordnung (EU) 2016/399) verstoßen könnte, mag zwar richtig sein, führt aber dazu, dass sich die öffentliche Debatte um die vermeintlich richtige Auslegung des Schengener Grenzkodex dreht und weniger darum, warum ein offenes Europa ein wünschenswertes Europa ist. Zumal mit dem Verweis auf die normative Autorität der Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 25 keine Überzeugungen gewonnen werden, sondern allenfalls Gefolgschaft erreicht wird. Die kann aber auch ausbleiben, was gravierende Folgen für unsere (Europa-)Rechtsordnung hätte.
Während also juristisches Wissen zwar beim Überzeugen hilfreich sein kann, sollten wir nicht vergessen, dass es egalitäres Überzeugen niemals ersetzen kann. Wer durch juristisches Sachwissen allein Gefolgschaft erwartet, wird in der nicht auf Rationalität ausgerichteten Wettbewerbsdemokratie Enttäuschung ernten. Gestritten werden sollte daher nicht (nur) um das bessere Rechtswissen, sondern um die konfligierenden sozialen Wertvorstellungen. Denn am Ende prädisponieren diese doch ohnehin, wie wir unser Rechtswissen argumentativ einsetzen.
Die (überschätze) argumentative Wirkung von Rechtsnormen
Politische Gestaltungsvorschläge mit vermeintlich überlegenem Rechtswissen entkräften zu wollen, ist nicht nur eine diskursverschiebende, sondern auch eine äußerst riskante Taktik.
Zunächst ist es natürlich nachvollziehbar, bestimmte Debatten mit einem Verweis auf entgegenstehende Rechtsnormen einzuhegen (zu versuchen). Je weiter die Diskrepanz zwischen der politischen Realität und der formalisierten Rechtsordnung reicht, kann – je nach politischer Einstellung – eine Flucht in die normative Gegenwelt gegenüber der Auseinandersetzung mit der politischen Realität vorzugswürdig erscheinen. Das wird verständlich, wenn man Rechtsnormen als eine formalisierte Form sozialer Praktik ansieht, wodurch sich eine „Gemeinschaft von der eigenen Realität distanziert“ (Möllers, Die Möglichkeit von Normen, 2018, S. 15). Denn erst indem Normen die reale Welt zurückweisen, eröffnen sie uns eine alternativ zu erreichende „Möglichkeit“ (Möllers). Wenn die Grundoperation des Normativen daher die Negation der Wirklichkeit ist, kann eine Bezugnahme auf die Autorität dieser alternativen Wirklichkeit verlockend sein.
Das zeigt sich in der Migrationsdebatte, wo die als unerträglich empfundene Realität, die nur eine Richtung zu kennen scheint (mehr Restriktionen), mit einem Rekurs auf die formalisierte Normativität eines offenen und humanitären Europas bewältigt werden soll (Stichwort „europarechtswidrig“). Das soll keinesfalls bedeuten, dass ein offenes und humanitäres Europa nur in einer normativen Utopie möglich wäre. Unmögliches zum Inhalt von Normen zu machen, wäre bei Zugrundlegung eines sozialen Normbegriffs nicht nur sinnlos, sondern eine Absage an deren Normativität. Die in den Europarechtsnormen angelegte Möglichkeit eines offenen Europas erscheint (oder erschien) durchaus realisierbar. Doch zumindest im Nachhinein kann sich diese Erwartung eben auch als unzutreffend erweisen. Das ist ein Defizit der argumentativen Inanspruchnahme von Normen, die den Argumentierenden bewusst sein sollte.
Wer sich in seiner Argumentation auf Rechtsnormen verlässt, vermeidet also nicht nur Überzeugungsarbeit in der Sache, sondern lenkt auch die Aufmerksamkeit auf deren Beständigkeit. Für die Sache kann diese Ablenkung wenig dienlich sein, denn Wesensmerkmal einer jeden Norm ist, dass sie verletzt oder verändert werden kann. Eine einfache Erwiderung auf die Flucht in eine normativ formalisierte Gegenwelt ist daher die Forderung, dass die entsprechenden Vorschriften dann eben außer Kraft zu setzen oder zu ändern seien. Auch dies war in der Migrationsdebatte zu beobachten, wenn Markus Söder oder Michael Kretschmer – sich auf das rechtliche Argument einlassend – gefordert haben, dann eben das Asylgrundrecht (Art. 16a GG) verändern zu wollen. Gleiches gilt für die Forderungen z.B. von Jens Spahn, die EMRK oder das Unionsrecht einmal außen vor zu lassen, da diese Regelungssysteme nun mal aus der Zeit gefallen seien.
Dieses Spiel kann dann bis zur Ebene der vermeintlichen Unverfügbarkeit der Rechtsnorm fortgeführt werden, wenn also letztlich auf eine Norm rekurriert wird, die etwas faktisch Mögliches verhindern soll, indem sie sich ihrerseits dem Zugriff der Normunterworfenen entzieht. Aus normtheoretischer Sicht kann das schon nicht erfolgreich sein, weil es in letzter Konsequenz keine unverfügbaren Normen gibt. Wenn die Menschenwürde nicht antastbar ist, warum müsste man dann die Unantastbarkeit normieren? Vielmehr dienen vermeintlich unverfügbare Normen als (wichtiges) rhetorische Mittel zur Verstärkung eines eigentlich verfügbaren normativen Anspruchs (Möllers, S. 417). Doch bei ausreichend Gegenwind können noch so starke Unverfügbarkeitsbehauptungen nicht verhindern, dass die Verfügbarkeit des Anspruches als solche entlarvt wird. Das hat sich gezeigt, als die europäischen Regelungen, die vormals noch als argumentativer Rettungsanker dienten, im Rahmen der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems verschärft wurden. Prompt sah der – nun zunächst wohl gescheiterte – Kabinettsentwurf zum GEAS-Anpassungsgesetz vormals undenkbare Verschärfungen z.B. bei der Inhaftierung von Familien und Kindern vor (vgl. § 70a Abs. 3 S. 3 AslyG-E).
Immerhin besteht im Verfassungsrecht das Unabänderlichkeitspostulat des Art. 79 Abs. 3 GG, das sich nur unter ungemein hohen politischen Kosten als eigentlich verfügbarer normativer Anspruch entlarven ließe. Doch selbst wenn man dieses als letzten normativ formalisierten Rettungsanker werfen möchte, müsste man begründen, dass der unabänderliche Kernbestand unserer Verfassungsordnung Verschärfungen der gegenwärtigen Migrationsrechtsordnung unzulässig macht. In der Auseinandersetzung mit Söders Forderung wurde dies in einem Artikel in DER ZEIT, der vielleicht symptomatisch für den ganzen Diskurs steht, auch so behauptet. Doch an diesem Punkt verliert dann sogar das Sachautoritätsargument überlegenen Rechtswissens seine Strahlkraft, denn natürlich musste DIE ZEIT in ihrer nächsten Ausgabe richtigstellen (DIE ZEIT No 42, S. 5), dass Söders Forderung nicht mit einem pauschalen Verweis auf die „Ewigkeitsgarantie“ des Art. 79 Abs. 3 GG („Art. 1 und 20 GG“) aus der Welt geschafft werden kann.
Wer also überzeugen will, darf sich nicht auf formalisierte Rechtssätze verlassen, sondern muss politischen Gestaltungsvorschlägen, seien sie auch noch so verwerflich, mit eigenen Wertvorstellungen argumentativ entgegentreten. Denn genau diese werden durch die Verschärfungsforderungen schließlich angegriffen. Es geht also darum, abseits komplizierter (richtiger) Subsumtionsleistungen für die Werte einzustehen, die auf dem Spiel stehen. Gerade Solidarität kann doch argumentativ auch ohne Formalisierung als soziale Norm der (Mehrheits-)Gesellschaft anerkannt und verteidigt werden. Wer aber – vielleicht aus Sorge vor dem Gegenargument – vermeidet, Solidarität und Humanität als Argumente gegen eine immer restriktivere Migrationspolitik ins Feld zu führen, wird eine offene Migrationsgesellschaft nicht allein mit normativer Autorität erfolgreich verteidigen können. Statt sich an vermeintliche normative Rettungsanker zu klammern, sollte man also erklären, was Solidarität bedeutet und wer diese Solidarität aus welchen Gründen dringend braucht.
Wie also dann weiter?
Natürlich ist es wichtig, möglichst rational und wissensbasiert über die rechtlichen Rahmenbedingungen von Migrationspolitik zu sprechen. Um eine politische Debatte einzuhegen, kann es auch sinnvoll sein, auf die Autorität von Rechtsnormen zu setzen. Denn die darin beschriebene Möglichkeit entsprechend zu handeln kann bereits das Ergreifen anderer Möglichkeiten faktisch erschweren (Möllers, S. 425). Doch ein Blick in die übrige EU (von den USA ganz zu schweigen) zeigt uns, dass wir uns nicht zu sehr darauf verlassen sollten, dass es ausreicht, die Umsetzung bestimmter politischer Vorschläge zu erschweren.
Überzeugen ist nicht einfach, sondern ein mühsames Unterfangen, das auch Scheitern kann. Wenn eine striktere Migrationspolitik gegen höherrangiges Recht verstößt, mag das häufig wahr sein und Verteidiger*innen einer offenen Gesellschaft in die Karten spielen, eine dauerhafte Mehrheit für das eigene politische Gesellschaftskonzept sichert man sich dadurch aber nicht. Gerade im bevorstehenden Wahlkampf lassen sich politische Angriffe auf die (Migrations-)Rechtsordnung nicht einfach mit einem Verweis auf diese abwehren. Gebraucht wird vielmehr eine argumentative Verteidigung der Werte, die in dieser Rechtsordnung (noch) formalisiert sind.