Keine allgemeine Verfassungsaufsicht über die Unionswerte im Vertragsverletzungsverfahren
Am 19. Dezember 2022 reichte die Europäische Kommission in der Rechtssache C-769/22 eine Vertragsverletzungsklage ein, in der sie im zweiten Klagegrund eine eigenständige Verletzung von Art. 2 EUV geltend machte. Dies löste eine breite Diskussion darüber aus, ob der EuGH seine Wertejudikatur in Zukunft so weiterentwickeln könnte, dass Art. 2 EUV auch als eigenständige Rechtsgrundlage herangezogen werden kann – ohne eine Verbindung zu spezifischen Bestimmungen des Unionsrechts. Der Juristische Dienst der Kommission hat diese Spekulationen jedoch nun zurückgewiesen. Im Rahmen der Anhörung des Verfahrens vom 19. November 2024 betonte der Generaldirektor des Juristischen Dienstes, Daniel Calleja Crespo, ausdrücklich, dass die Klage der Kommission nicht dahingehend verstanden werden dürfe, Art. 2 EUV könne ohne Bezug zu anderen Normen oder außerhalb des Anwendungsbereichs des Unionsrechts eigenständig gerügt werden.
„Größter Menschenrechtsprozess in der Geschichte der Europäischen Union“
Das von einigen Beobachtern als „größter Menschenrechtsprozess in der Geschichte der Europäischen Union“ bezeichnete Verfahren betrifft das von der Europäischen Kommission am 19. Dezember 2022 eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn. Anlass ist ein ungarisches Gesetz, das die Darstellung von Homosexualität und Transsexualität gegenüber Minderjährigen in Bildungseinrichtungen, Medien und Werbung einschränkt. Das im Juni 2021 verabschiedete Gesetz LXXIX von 2021 ändert unter anderem das ungarische Kinderschutzgesetz und das nationale Bildungsgesetz und untersagt pauschal die „Förderung“ von Homosexualität und Geschlechtsumwandlung gegenüber Personen unter 18 Jahren. Zusätzlich beschränkt es Bücher und audiovisuelle Inhalte, die LGBTIQ*-Themen behandeln.
Die Europäische Kommission sieht in dem betreffenden Gesetz schwerwiegende Verstöße gegen Unionsrecht. Im ersten Klagegrund rügt sie Verstöße gegen mehrere Sekundärrechtsakte, darunter Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste, Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr sowie Art. 16 und 19 der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt. Zudem macht sie Verletzungen der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV sowie der Grundrechte aus Art. 1, 7, 11 und 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union geltend. Im zweiten Klagegrund geht die Kommission allerdings noch einen Schritt weiter und beruft sich auf eine eigenständige Verletzung von Art. 2 EUV, der die Werte der Union schützt.
Europaverfassungsrecht und die Frage der Wertejudikatur des EuGH
Aus Sicht des Unionsverfassungsrechts wirft der Fall eine zentrale Frage auf: Wie weit reicht die Justiziabilität der Werte des Art. 2 EUV? Dass der EuGH im Ergebnis zur Unionswidrigkeit des ungarischen Gesetzes kommen wird, scheint sicher – nicht umsonst haben sich 16 Mitgliedstaaten der Klage der Kommission angeschlossen, ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und für die konsequente Durchsetzung der Menschenrechte. Spannend ist aber die mögliche Fortentwicklung der Wertejudikatur des EuGH.
Mit der ASJP-Entscheidung hat der EuGH klargestellt, dass Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV eine Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips darstellt. Dieser neue Rechtsprechungsansatz ermöglicht es dem EuGH nun, den Wert der Rechtsstaatlichkeit gegenüber den Mitgliedstaaten durchzusetzen. Für einen effektiven Rechtsschutz, den die mitgliedstaatlichen Gerichte nach Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV zu gewährleisten haben, ist nach Auffassung des EuGH gegenseitiges Vertrauen zwischen den Gerichten unerlässlich. Dieses Vertrauen setze die Achtung der richterlichen Unabhängigkeit voraus, die über das Rechtsstaatsprinzip auch in Art. 2 EUV verankert sei.
Damit hat sich der EuGH im Rahmen von Vorabentscheidungs- bzw. Vertragsverletzungsverfahren jedenfalls insoweit die Jurisdiktionsgewalt auch über rein mitgliedstaatliche Institutionen wie die Justiz gesichert, als es um die Frage der Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit geht. In seiner weiteren Rechtsprechung hat er die Maßstäbe präzisiert. Waren ursprünglich systemische Mängel und die konkrete Gefahr der Verletzung absolut geschützter Grundrechte im Einzelfall Voraussetzung für die Aussetzung der justiziellen Zusammenarbeit (Rs. L.M.), hat der EuGH in der Repubblika-Entscheidung ein Rückschrittsverbot eingeführt. Dieses verbietet es den Mitgliedstaaten, das rechtsstaatlich erreichte Schutzniveau abzusenken. Die Begründung dafür ist, dass die gemäß Art. 49 EUV für den Beitritt notwendige Bindung an die Werte des Art. 2 EUV auch während der gesamten Dauer der Mitgliedschaft gelte. Auf dieser Grundlage könnte der EuGH in Zukunft möglicherweise einen noch weitergehenden Wertevorbehalt entwickeln.
Art. 2 EUV als Stand-Alone-Norm?
Das vorliegende Verfahren geht jedoch weit über die Frage der richterlichen Unabhängigkeit als Teilaspekt des Rechtsstaatsprinzips hinaus. Es geht nicht um effektiven Rechtsschutz oder gegenseitiges Vertrauen der Gerichte, weshalb Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV hier nicht einschlägig ist. Vielmehr geht es um die Diskriminierung von LGBTIQ* und damit um Grundrechte und deren Menschenwürdekern. Diese Grundrechte sind auf Unionsebene sowohl in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Unionsrechts als auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh ist die Charta allerdings nur anwendbar, wenn ein Zusammenhang mit der „Durchführung des Unionsrechts“ besteht. Zwar legt der EuGH diesen Anwendungsbereich seit dem Urteil Åkerberg Fransson weit aus, dennoch ist ein konkreter Bezug zum Unionsrecht erforderlich. Im vorliegenden Verfahren dürfte diese Voraussetzung unproblematisch erfüllt sein, da ein Binnenmarktbezug besteht, der jedenfalls auch den Anwendungsbereich der Grundrechtecharta eröffnet.
Umso erstaunlicher ist es, dass die Europäische Kommission in ihrer Klage vom 19. Dezember 2022 zusätzlich einen Verstoß gegen Art. 2 EUV geltend macht. An anderer Stelle ist von einer „Signalwirkung“ die Rede. Viele Beobachter haben dies als Hinweis darauf gewertet, dass nach Auffassung der Kommission ein Verstoß gegen Art. 2 EUV auch unabhängig von konkreten Sekundär- oder Primärrechtsverletzungen – insbesondere auch unabhängig vom Anwendungsbereich der Grundrechtecharta – möglich sein könnte. Ein solcher Ansatz wäre ein Novum: Erstmals würden die in Art. 2 EUV verankerten Werte der Union als eigenständige Rechtsgrundlage für eine Vertragsverletzungsklage herangezogen, ohne dass es auf die Verletzung weiterer konkreter Vorschriften ankäme. Art. 2 EUV würde in diesem Fall gewissermaßen eigenständig den Anwendungsbereich des Unionsrechts (neu) konturieren. Dies wäre nach Ansicht mancher Beobachter durchaus wünschenswert, da Art. 2 EUV selbst ausdrücklich ja keine Aussagen hinsichtlich seines Anwendungsbereichs trifft.
Enges Verständnis der Europäischen Kommission
Zumindest die Europäische Kommission hat einem solchen weiten Verständnis von Art. 2 EUV nun allerdings eine klare Absage erteilt. Zwar wurde in der Klageschrift in der Rechtssache C-769/22 ein eigenständiger Verstoß gegen Art. 2 EUV als Klagegrund aufgeführt, doch stellte der Generaldirektor des Juristischen Dienstes, Daniel Calleja Crespo, im Laufe der Anhörung klar, dass Art. 2 EUV nur in Verbindung mit anderen unionsrechtlichen Bestimmungen und nur innerhalb des sachlichen Anwendungsbereichs des Unionsrechts geltend gemacht werden könne. Diese Klarstellung erfolgte auf wiederholte Nachfrage insbesondere des Richters Passer, der – wie viele Stimmen aus dem Schrifttum auch – die Klageschrift zunächst so verstanden hatte, dass Art. 2 EUV eigenständig anwendbar sei. Er stellte unmissverständlich die Frage, ob eine Verletzung des Art. 2 EUV „unabhängig von anderen Bestimmungen des Unionsrechts“ möglich sei und verlangte eine klare Antwort. Der Generaldirektor des Juristischen Dienstes der Kommission verneinte dies nun ausdrücklich. Auf die weitere Frage, ob der zweite Klagegrund zurückgewiesen werden müsse, wenn der erste Klagegrund scheitert, antwortete er explizit mit „Ja“ und stellte klar, dass es einer Eröffnung des Anwendungsbereichs des Unionsrechts bedürfe, die Art. 2 EUV selbst nicht bewirken könne. Damit steht fest, dass Art. 2 EUV nach Auffassung der Kommission nur dann anwendbar ist, wenn auch konkrete Verstöße gegen andere Vorschriften des Unionsrechts vorliegen und nur eingeklagt werden kann, wenn sich die fragliche Maßnahme innerhalb des Anwendungsbereichs des Unionsrechts bewegt.
Positionierung des EuGH noch offen
Ob die nunmehr klare Position der Kommission auch den EuGH überzeugt hat, bleibt abzuwarten. Die Äußerungen von Präsident Koen Lenaerts in der mündlichen Verhandlung deuten darauf hin, dass er die restriktive Auslegung der Kommission mit einem gewissen Unbehagen betrachtet. So stellte er die Position explizit in Frage und betonte, dass Art. 2 EUV im Rahmen des Art. 7 EUV-Verfahrens und beim Beitritt gemäß Art. 49 EUV doch auch außerhalb der materiellen Kompetenzbereiche des Unionsrechts durchgesetzt werden könne. Er wies den Generaldirektor des Juristischen Dienstes der Kommission darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine Einschränkung des materiellen Anwendungsbereichs von Art. 2 EUV handele, sondern dass sich eine solche Beschränkung vielmehr allein aus der begrenzten Reichweite des Vertragsverletzungsverfahrens ergebe. Der EuGH könnte die Äußerungen des Kommissionsvertreters also möglicherweise dahingehend interpretieren, dass das Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258 AEUV zwar auf den Anwendungsbereich des Unionsrechts beschränkt ist, ohne dabei die umfassende Geltung des Art. 2 EUV zu beeinträchtigen.
Diese Haltung ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass Koen Lenaerts in seinem gemeinsam mit Piet van Nuffel verfassten Lehrbuch zum Europäischen Verfassungsrecht die Werte der Union aus Art. 2 EUV im Kapitel über die Kompetenzen der Europäischen Union diskutiert. Der Trend im Unionsrecht, die Grundrechte der Union zur Ableitung unionaler Kompetenzen zu nutzen – wie neuerdings im European Media Freedom Act eindrücklich ersichtlich – und nun auch neue Rechtsprechungsbefugnisse aus den Unionswerten – seit dem ASJP-Urteil – abzuleiten, existiert jedenfalls schon länger. Ein derart enges Verständnis des Art. 2 EUV, wie es nun von der Kommission geäußert wird, passt damit nicht zusammen und könnte auch eine zukünftige Ausweitung der EuGH-Rechtsprechung erschweren. Diese Rechtsprechung sieht seit dem Urteil in der Rechtssache Repubblika eine generelle Verpflichtung zur Nichtregression vor und könnte bei extensiver Auslegung, insbesondere mit Blick auf die Formulierung im Urteil, wonach Art. 2 EUV als Voraussetzung für den Genuss aller Rechte aus den Unionsverträgen verstanden wird, möglicherweise in Zukunft zu einem kompetenzrechtlich problematischen generellen ordre public communautaire-Vorbehalt führen.
Bemerkenswert an den Ausführungen des EuGH-Präsidenten in der mündlichen Verhandlung ist, dass er wiederholt versucht hat, die Reichweite des Art. 2 EUV mit einer Parallele zu Art. 7 EUV zu begründen. Bahnt sich hier möglicherweise ein neuer dogmatischer Begründungsversuch der Wertejudikatur an? Überzeugend wäre das jedenfalls nicht, denn gerade, weil es zutrifft, dass im Rahmen des Art. 7 EUV-Verfahrens auch rein innerstaatliche schwerwiegende Werteverletzungen adressiert werden können, ist das Art. 7-Verfahren so ausgestaltet, dass der EuGH hier keine materielle Kontrolle ausübt, sondern auf eine Verfahrenskontrolle beschränkt ist. Aus der systematischen Konzeption des Art. 7 EUV, der das Rechtsstaatlichkeitsverfahren als ein politisches Verfahren zwischen gleichberechtigten Partnern („peers“) ausgestaltet – erkennbar am nur zweistufigen Sanktionsmechanismus, der Konsultation der Mitgliedstaaten, den hohen Mehrheitserfordernissen, der zentralen Rolle des Rates und insbesondere des Europäischen Rates sowie der Beschränkung der Zuständigkeit des EuGH auf reine Verfahrensfragen – folgt, dass dem EuGH eine eigenständige, anwendungsunabhängige Durchsetzung der Werte gegenüber den Mitgliedstaaten gerade nicht möglich ist.
Daniel Calleja Crespo ließ sich auf diese akademische Frage, die eher für die künftige Entwicklung der Rechtsprechung relevant sein wird, dann auch nicht weiter ein, sondern wies darauf hin, dass die Anknüpfung an den Anwendungsbereich des Unionsrechts jedenfalls notwendig sei und es ja in jedem Fall um ein Vertragsverletzungsverfahren gehe. Präsident Lenaerts akzeptierte dies insoweit, widersprach jedoch noch einmal der Annahme, dass sich diese Einschränkung unmittelbar aus Art. 2 EUV ergebe. Er argumentierte, dass Art. 2 EUV z.B. im Rahmen von Art. 49 EUV auch außerhalb des sachlichen Anwendungsbereichs des Unionsrechts relevant sein könne – ein Argument, auf dem auch die Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Rückschrittsverbot fußt.
Dogmatische Unbegründbarkeit einer Umformung des Art. 2 EUV zum allgemeinen Wertevorbehalt
Das letzte Wort in der Entwicklung Wertejudikatur des EuGH ist also noch lange nicht gesprochen. Die Verfechter einer extensiven Auslegung des Art. 2 werden von der Position der Kommission deutlich enttäuscht sein, können aber hoffen, dass der EuGH seine ASJP-Rechtsprechung, die Präsident Lenaerts selbst als „konstitutionelles Moment“ der Europäischen Union bezeichnet hat und deren Bedeutung er und viele anderen in der Tradition von Costa/ENEL und Van Gend & Loos sehen, weiter verteidigen und fortführen wird. Für eine umfassende dogmatische Analyse ist im Rahmen eines Blogposts nicht der Platz – die Argumente sind auch schon oft ausgetauscht worden. Zumindest aus rein dogmatischer Sicht ohne rechtspolitische Wertungen ist klar, dass eine anwendungsunabhängige Durchsetzung des Art. 2 ausdrücklich nur im Verfahren des Art. 7 EUV möglich ist. Eine über den sonstigen Anwendungsbereich des Unionsrechts hinausgehende Wertejudikatur des EuGH auf der Grundlage von Art. 2 EUV wäre zudem vom Anwendungsbereich des Vertragsverletzungsverfahrens nicht gedeckt (Art. 258 und 259 AEUV sprechen ausdrücklich von der Verletzung „einer Pflicht aus den Verträgen“), und würde zumindest potentiell den Anwendungsbereich der Grundrechtecharta nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh unterlaufen, sollten weitere Werte des Art. 2 EUV operabel gemacht werden. Letztlich ist der EuGH auch institutionell nicht legitimiert durch reine Rechtsfortbildung, die Europäische Union auf eine neue Stufe des Wertekonstitutionalismus zu heben. Art. 2 EUV ist keine Metaverfassung, aus der Norm folgt kein allgemeiner Maßstab, an dem sich die mitgliedstaatlichen Verfassungen messen lassen müssen, und der EuGH ist nicht zur Verfassungsaufsicht über originär mitgliedstaatliche Verfassungsbereiche befugt.
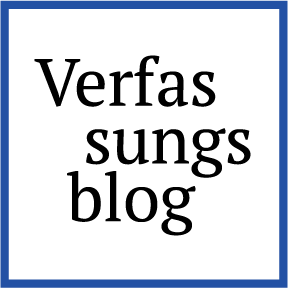
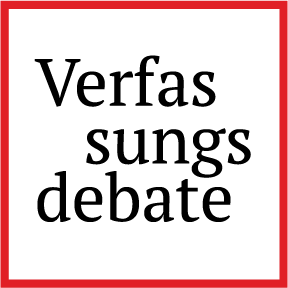
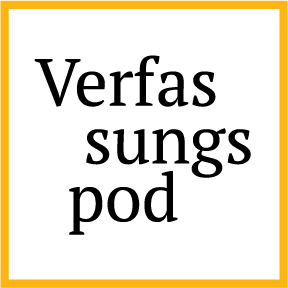
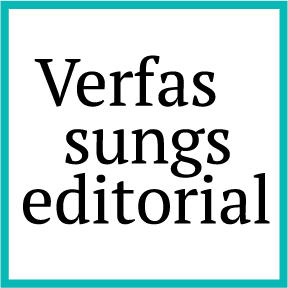

Zu dem interessanten Beitrag von Herrn Riedl möchte ich zwei Anmerkungen vorwiegend begrifflich-konzeptioneller Natur machen:
Erstens zweifle ich, dass das in Deutschland so gern in die Hand genommene “große Besteck” (“Metaverfassung”, “Verfassungsaufsicht”, “originär mitgliedstaatliche Verfassungsbereiche” etc.) wirklich dabei hilft, die schwierigen Fragen zu beantworten, die sich hier stellen. Um eine “Verfassungsaufsicht” geht es in den meisten Fällen ja nicht, sondern (wie im Beispielsfall, der dann eher für eine Projektion künftiger Entwicklungen genutzt wird) um eine unionsverfassungsrechtliche Prüfung “einfacher” (wenn ich mir diese Vereinfachung ohne rechtsvergleichenden Kontext erlauben darf) Rechtsakte. Und was will man mit der “Metaverfassung” dann auslösen außer Abwehrreflexen gegen etwas, was nicht nur demokratisch gewollt und verantwortet ist, sondern vom Grundgesetz sogar ganz ausdrücklich verlangt wird: nämlich eine überstaatliche Integration mit Durchgriffswirkung, die von Hause aus nur eine
vorrangige sein kann? Die
Existenz “originär mitgliedstaatlicher Verfassungsbereiche” ist eine Setzung, und zwar eine, die dann doch nicht ohne rechtspolitische Wertungen auskommt, wie es der Verfasser explizit für sich in Anspruch nimmt. Nicht zutreffend ist jedenfalls die Einordnung der Justiz als “rein mitgliedstaatlich”: Der Rechtsprechungsverbund geht aus dem Primärrecht ja überdeutlich hervor und ist insofern keine Erfindung des Gerichtshofs. Aber auch darüber hinaus ist gerade die Frage, ob (und wenn ja, inwieweit) es originär mitgliedstaatliche Bereiche noch gibt – und woran man sie erkennen könnte. Man mag nun Art. 2 EUV en détail verstehen wie man will, aber dass das Unionsverfassungsrecht irgendwie eine Grundspannung (mindestens ein Verhältnis) anlegt zwischen dieser Norm und Art. 4 Abs. 2 EUV (“Achtung” der mitgliedstaatlichen Identitäten), das muss man schon übersehen wollen. Und wenn
man mit originär – was ja nichts Anderes heißt als (allseitig) „integrationsfest“ – anfängt, löst man diese (einseitig) auf. Will heißen: Wenn man mit Begriffen und durch sie reflektierten Vorverständnissen in die Debatte geht, muss man sich nicht wundern, wenn die Ergebnisse schon feststehen, noch bevor man sich auf die Debatte eingelassen hat. Es geht mir nicht darum, dass man über die verbundverfassungsrechtlichen Grundfragen, die der Beitrag aufwirft, nicht anderer Meinung sein könnte. Gerade weil das so ist, kommt es aber sehr entscheidend auf die Begriffe und die damit transportierten Grundannahmen an.
Zweitens möchte ich etwas sagen zum Umgang mit dem „Anwendungsbereich des Unionsrechts“. Er wird eingeführt, als stünde er so fest, dass man sich mit damit nicht mehr groß aufzuhalten braucht. Das ist aber nicht so: Erstens müsste man generell einmal fragen, ob – und wofür – diese Figur aus der Frühzeit der Integration heute noch gebraucht wird (auch und gerade weil der Ansatz von Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh begrifflich ja ein anderer ist, wobei ich sehe, dass Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV auf die „vom Unionsrecht erfassten Bereiche“ abstellt). Zweitens ist mein Eindruck, dass sich Konstellationen außerhalb des Anwendungsbereichs des Unionsrechts bei genauer Betrachtung gar nicht mehr so einfach finden lassen, eben weil das Sekundärrecht so vielfältig ist und häufig Querschnittsansätze verfolgt. Drittens müsste die offenkundige Prämisse des Beitrags, dass Art. 2 EUV selbst jedenfalls nicht zum Anwendungsbereich des Unionsrechts gehört oder ihn nicht allein eröffnet, auch begründet werden. Solange man nicht sagen will, dass die Norm für die Mitgliedstaaten gar keine Verpflichtungswirkung hat, und das scheint mir ganz unabhängig von der entfaltenden Judikatur doch schwer haltbar zu sein, wenn man sich nicht in (hier fruchtlose) Theoretisierungen des Wertebegriffs flüchten möchte, dürfte diese Begründung nicht leicht fallen. Die Justiziabilitätsfrage wäre aus meiner Sicht dann schon wieder eine andere, weshalb ich auch nicht genau verstehe, was das Art. 7 EUV-Verfahren zur materiellen Komplementarität eigentlich besagen soll (oder auch nur könnte). Ich möchte ausdrücklich die Probleme der Judikatur nicht übersehen und verstehe die auch mich umtreibende Frage gut, ob Art. 2 EUV etwa die begrenzte Verpflichtungswirkung der Unionsgrundrechte für die Mitgliedstaaten nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 GRCh aushebeln kann. Ich halte es aber nicht für weiterführend, wenn so getan wird, als wären die Dinge eigentlich sehr einfach, wenn man nur mal rein dogmatisch die Dinge ins rechte Verhältnis setzt.